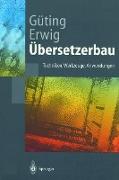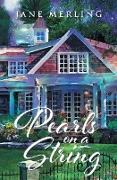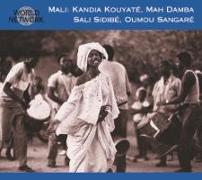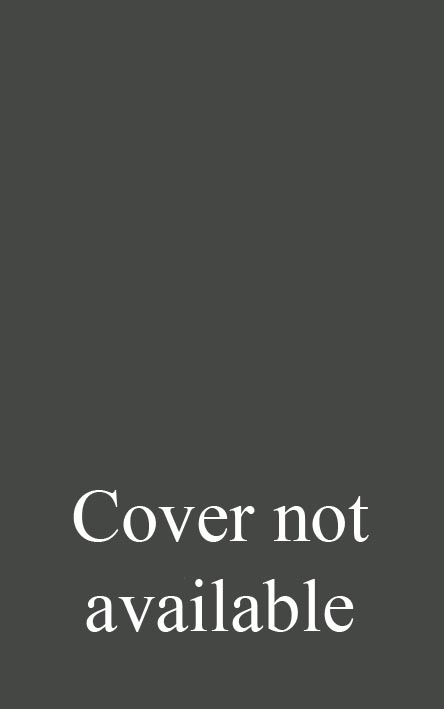Lebendige Prozesse
BücherAngebote / Angebote:
Seit es die plastische Kunst gibt, seit vielen tausenden von Jahren,
angefangen bei den alten Persern über die ägyptischbabylonische
Zeit bis hin zu den Griechen, dann weiter über die
Römer, hinein zur frühchristlichen Plastik, weiter hin zu der
Romanik und wieder weiter über die Gotik in den Zeitraum der
Renaissance und später zum Barock, Klassizismus usw. und
noch bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts zu Bildhauern wie
Archipenko, Rodin, Camille Claudel usf. - kurz, seit tausenden von
Jahren bis vor knapp 100 Jahren - suchte der Künstler, der Bildhauer,
im Stoff selber, in dessen Gesetzmäßigkeiten, im Wölben
und Buchten der Flächen - im eigentlichen Sinne plastisch empfindend
- zu seiner Form zu kommen.
Erst im 20. Jahrhundert wurden, zunächst vereinzelt, dann immer
stärker, Bemühungen im künstlerischen Schaffen erkennbar,
welche die Naturform zu abstrahieren versuchten: Weg
von der konkreten Figürlichkeit und weg vom konkreten Bild.
Und in der fortschreitenden Zeit traten immer mehr Künstler
und Bildhauer auf, welche ein Verhältnis zum Stoff an sich und
einer Gestaltung aus dessen eigener plastischen Gesetz-mäßigkeit
heraus, verloren.
Auf der einen Seite kam es immer mehr zu konstruktiven Darstellungen.
Dabei verließen die Künstler den Boden für natürliche
Materialien wie Ton, Holz und Stein usw., und sie
begannen aus vielen neuen Kombinationen wie Glas, Jute, Metall,
Holz, Plastik, Textilien und vielem mehr heraus zu gestalten
und zu kombinieren. Dieser Schritt erweiterte einerseits die
Möglichkeiten der abstrakten Formgebung. Auf der anderen
Seite büsste man damit aber an Plastizität, Lebendigkeit und
Beweglichkeit ein, was die besonderen Qualitäten des Tones
sind.
Die Ideen, oder besser gesagt die Vorstellungen im Kopf der
Künstler gewannen zunehmend an Gewicht. Die Ausführung
selber wurde zum sekundären, rein technisch-handwerklichen Akt degradiert. Damit wurde der künstlerische Prozess aus
dem ganzen Menschen gehoben und in der nackten Idee, in der
bloßen Vorstellung fixiert. Darauf werde ich in einigen Kapiteln
näher eingehen.
Auf der anderen Seite kam es aber auch zur bewusst ideenlosen
Gestaltung, welche in Polarität zur erstbenannten steht, zur
Herrschaft eines puren Willensaktes und einer bloßen, meist
unbewussten oder halbbewussten Emotion, welche sich ihren
eigenständigen Raum in der bildenden Kunst zu schaffen suchte,
ohne jegliche "Vernunft", sich ihnen selbst überlassend, "aus
dem Bauche heraus". Aber auch hier wurde der Stoff, das Material
an sich, mit seinen spezifischen Gesetzmäßigkeiten vergessen,
dies umso mehr, als zu der Formung der plastischen
Objekte zunehmend auch eine maschinelle Bearbeitung überhand
nahm und die unmittelbare Gestaltungskraft der Hände
infolge dessen mehr und mehr abgeschwächt wurde. Dieser
Umstand schaffte mit der physischen, zunehmend auch eine
seelische Distanz zum geschaffenen Objekt.
Die Spaltung in diese zwei Richtungen - jener aus den Vorstellungskräften
auf der einen Seite und der anderen, polar entgegen
gesetzten aus den Kräften eines begierdehaften Willens -
dramatisierte sich vor allem am Anfang des 20. Jahrhunderts.
Man findet sie allerdings immer wieder in der kunstgeschichtlichen
Entwicklung des Abendlandes, so auch veranlagt als
ägyptische auf der einen oder babylonisch-sumerischmesopotamische
Strömung auf der anderen Seite, oder aber, in
neuerer Zeit, im Wesen des Impressionismus und des Expressionismus.
In diesen beiden Strömungen konnte man allerdings
noch eine einheitlichere Form empfinden und ein Gefühl für
die Ganzheit entwickeln. In der anthroposophischen Geisteswissenschaft
werden diese Kunstströmungen auch Nordstrom
oder Südstrom genannt.
Was mit dieser Polarisierung gemeint ist, wird in eindrücklicher
Weise von Friedrich Schiller in seinen "Briefen zur
ästhetischen Erziehung des Menschen" beschrieben. Er schilderte diese beiden Polaritäten sehr ausführlich und nannte sie Formtrieb
und Stofftrieb. Die treibende und impulsierende Mittekraft
nennt er den Spieltrieb: In ihm sind die Herzenskräfte angesprochen.
Darinnen kann der eigentliche künstlerische Impuls gesehen
werden, wie er hier verstanden wird. Darinnen liegt die
Freiheit des Menschen begründet.
Die Verselbständigung in die zwei oben beschriebenen Richtungen
kann bei jedem gestaltenden Menschen mehr oder weniger
deutlich im Schaffensprozess beobachtet werden. Sie kann
sich allerdings in eine Einseitigkeit steigern, die von ihm als
unfrei empfunden wird oder als solche sogar in eine Krankheitssituation
führt, indem sie sich in der physischen und/oder
seelisch-geistigen Konstitution manifestiert. Hier wird ein wichtiger
Grundsatz angesprochen:
Die plastisch-künstlerische Therapie will helfen, die polarisierenden
Kräfte zwischen Stoff und Form zum Ausgleich zu
bringen.
Mit dieser Arbeit soll der Versuch gewagt werden, dem interessierten
Leser das Gebiet der anthroposophischen Kunsttherapie
etwas näher zu bringen. Dabei soll selbst-verständlich nicht
gemeint sein, dass die Sache in er-schöpfender Weise behandelt
wird. Was hier vorliegt, ist selbst einem dauernden Wandel unterlegen,
wird laufend ergänzt, neu umschrieben oder wieder
herausgenommen. Diese Schrift soll selber ein stetig wachsender,
schöpferischer Akt bleiben, welcher aus dem immer neu
sich übenden Nachklang der Therapietätigkeit entspringt. So
wird der Umfang immer größer, differenzierter und die Zusammenhänge
umfassender im Laufe des Lernprozesses. Diese
Methode des Schaffens ist mir wichtig und spiegelt auch Wesentliches
aus der thera-peutischen Arbeit wieder. Mag auch
zunächst ein Mangel an klaren Strukturen, an intellektueller
Gliederung der ver-schiedenen Künste und deren Bezug zum
Menschen usw. vorliegen, so ist einer verbalen Auseinandersetzung
über diese Kunsttherapien nur dadurch gerecht zu werden,
dass sie selbst als wachsendes, lebendiges und ringendes
Wesen aus der therapeutischen Tätigkeit heraus entstehen will.
Folgt in ca. 2-3 Arbeitstagen